Schuld & Macht
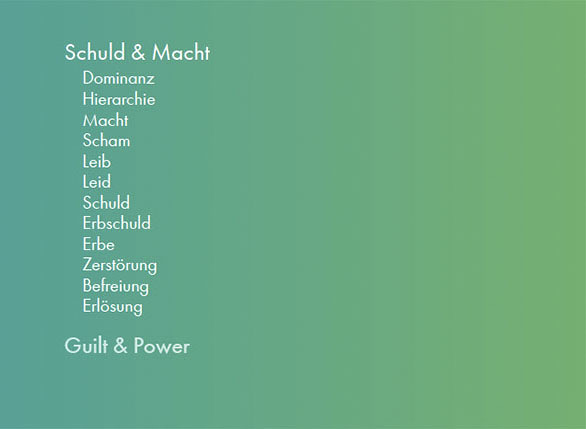
Aus: Reflektiert zeitgenössische Kunst das Christentum? Ein kuratorisches Gespräch zwischen Katrin Bucher Trantow, Johannes Rauchenberger und Barbara Steiner | Is Christianty Reflected in Contemporary Art? A conversation between Katrin Bucher Trantow, Johannes Rauchenberger and Barbara Steiner, in: Glaube Liebe Hoffnung. Zeitgenössische Kunst reflektiert das Christentum | Faith Love Hope. Christianity Reflected in Contemporary Art, herausgegeben von | edited by Katrin Bucher Trantow, Johannes Rauchenberger, Barbara Steiner, (IKON. Bild+Theologie, hg. von | ed. by Alex Stock und Reinhard Hoeps), Verlag Ferdinand Schoeningh, Paderborn 2018, S. | p. 138-147.
Johannes Rauchenberger: Es ist schon ein unerhörter Widerspruch: Von der Kirche Enttäuschte oder sich aus unterschiedlichen, mitunter sehr persönlichen Gründen verletzt Fühlende verbinden die Kirche vielfach mit dem Etikett „Macht“ und „Schuld“. Dabei behauptet die kirchliche Botschaft genau das Gegenteil: Es geht letztlich um Ohnmacht und um Erlösung, also die Befreiung von Schuld. In der Theologie wird „Glauben“ als ein Grundakt des Vertrauens, der Hingabe formuliert: Gerade angesichts der neuzeitlichen Kritik, die der Kirche entgegenwehte, hat sich Theologie zu ganz außerordentlichen gedanklichen Konstruktionen aufgeschwungen. Zustimmung, Freiheit und Gnade verbinden sich zu Formen des Glaubens – da haben Angst, Zwang und ein „Es war immer so“ längst nichts mehr verloren. „Fundamentaltheologie“ ist eine Disziplin, wo man Derartiges lernt – auf der Höhe des philosophischen und kulturellen Diskurses. „Fundamentaltheologie“ hat jedoch nichts mit Fundamentalismus zu tun, vielmehr ist es das Gegenteil davon. Es ist der Versuch, den Glauben mit den Mitteln der Vernunft einzuholen. Die Disziplin entstand, als erst der Katholizismus (durch die Reformation), dann das Christentum (durch die zunehmende Globalisierung) und schließlich die Religion selbst (durch den Atheismus) infrage gestellt wurden. Deshalb hat diese Disziplin immer das Gespräch gesucht – mit denen, die sie eben infrage gestellt haben. Und natürlich sind wir über die Jahrhunderte auch mit Schattenseiten konfrontiert worden: Die Geschichte der Bilder erzählt von der Angst, der Angst vor der Bestrafung, der Schuld und den Schuldgefühlen. Kunst arbeitet sich verständlicherweise verstärkt daran ab.
Barbara Steiner: In unserer Ausstellung finden wir beides: Vertrauen und Furcht. Maria Kramer ist das perfekte Beispiel für einen solchen Grundakt des Vertrauens. Ihr Leben war von Schicksalsschlägen gekennzeichnet, doch sie hat ihren Glauben nicht verloren, fühlte sich ganz von ihm durchdrungen. Andere Künstlerinnen und Künstler formulieren ihre Kritik genau an dieser für sie fatalen Durchdringung aller Lebensbereiche – die kaum Raum für Abweichungen lässt. Das macht Angst, erzeugt Zwang. Angesichts des von Johannes erwähnten „Es war immer so“ wird Erneuerung undenkbar. Man kann bestimmte Formen der Unterdrückung auch noch Jahrzehnte später über den Einsatz der Sprache, über gewisse Formulierungen gut nachvollziehen. Ideale, aber auch Forderungen eines frommen Verhaltens schreiben sich in Sprache ein.
Hannes Priesch hat ein feines Sensorium für diese Art von Materialien, man denke nur an seine Arbeit, in der er monatelang Legenden von Heiligen wie ein Skriptor „abschreibt“. Sie stammen alle aus dem Buch Legende von den lieben Heiligen Gottes nach den besten Quellen neu bearbeitet und herausgegeben von Georg Ott, Priester der Diözese Regensburg aus dem Jahr 1854. Es stellt die jeweiligen Tagesheiligen der katholischen Kirche in der Sprache des 19. Jahrhunderts vor. Zwar nicht ganz offiziell, aber, wie am Titelblatt vermerkt ist, „mit oberhirtlicher Gutheißung“. Angesichts des Lebens dieser Heiligen muss man sich unentwegt schuldig fühlen. Durch Prieschs Wiederholung, die auch ein Stück weit Aneignung ist, unterwirft er sich selbst einer Art Ritual, das allerdings auch befreiende Wirkung hat. Dazu kommen reliquienartige kleine Gaben, die alle von ihm selbst stammen: Haare, ein Stück Kleidung, Blut usw.
Katrin Bucher Trantow: Als wir im Gespräch über diese Arbeiten, die auch Sticknähte in Form von Zeichenlinien zeigen, auf die Verwandtschaft von textilen Mustern und religiösen Ritualen kamen, erzählte er von der eben erwähnten Maria Kramer, seiner alten, zutiefst gläubigen Schwiegermutter und deren beeindruckenden Arbeiten auf Stoff, die sie noch immer – wenn auch nur mehr vermeintlich in halbwachen Tagträumen – zu sticken glaubte. In der Tat mischen sich Glaube, Hingabe, Vertrauen und Verzückung in den expressiven und farbenprächtigen Stickarbeiten. Maria Kramer, die mit ihren Heiligen- und Madonnenstickereien ihre Zeit im hohen Alter füllte, verstarb am Tag unseres Gesprächs. Es war, als hätte sie eine Botschaft hinterlassen: Trotz nahezu totaler Blindheit vermochte sie bis weit über neunzig aus der Erinnerung die Marienandachtsbilder zu sticken, die schon wegen der Fahrigkeit der bunten Linien, der Großzügigkeit der abstrahierten Form eine ungeheure Direktheit und Inbrunst ausstrahlen. Die Bilder sprechen von einem Trost der eigenen Handlung und des religiösen Dialoges und schließen in beeindruckender Weise den zu Beginn der Ausstellung eröffneten Kreis zur Muttergottes als Beschützerin und Helferin aller Suchenden.
JR: Hannes Priesch kennt also in seinem unmittelbaren biografischen Kontext beide Seiten eines „sakralen Bildes“: Unbedingte Hinwendung, aus dem so etwas wie Trost zu holen wäre – quasi bis in die Todesstunde hinein: „Heilige Maria, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Todesstunde, Amen!“, lautet ja am Ende daskatholische Gebet, nämlich das „Ave Maria“. Das ist auch ein tägliches „Memento Mori“, im Sinne eines rituellen Wiederholens, um der eigenen Hybris etwas entgegenzusetzen. Die andere Seite erzeugt ebenso eine unbedingte Bindung aller Lebensenergien, die ins Pathologische kippen kann. Und genau das hebt Hannes Priesch mit seinen Heiligenviten ins Bild. Sie verstören wirklich.
Der Kunsthistoriker Werner Hofmann (1928–2013) hat in seiner bahnbrechenden Ausstellung Luther und die Folgen für die Kunst 1983 anlässlich der 500. Wiederkehr des Geburtstages Martin Luthers in der Hamburger Kunsthalle der gegenreformatorischen Bildstrategie vor allem „Pathos von Leiden und Triumphieren“[29]unterstellt. Und man kann ihm nicht widersprechen. Unsere Bildwelt der Steiermark ist voll davon, auch wenn die dazugehörige Praxis wie Kreuzwegandachten, Kalvarienbergsprozessionen heute ganz reduziert oder fast zur Gänze verschwunden sind. Doch Priesch erinnert mit seiner Chapel of Pain [30]mit Nachdruck daran – freilich mit einer Quelle, die in einer Zeit geschrieben wurde, als auch der pathetisch-leidende Barock schon wieder Geschichte und in die restaurative Haltung des 19. Jahrhunderts gefallen war. In Zeiten der Globalisierung wird deutlich, dass diese Praktiken der Geißelungen und öffentlichen Kreuzigungen keineswegs verschwunden sind. Sie tauchen nur andernorts auf.
BS: Ich möchte nochmals auf Fragen der Schuld zurückkommen: Santiago Sierra und auch MajaBajević wenden sich dieser Frage sehr konkret zu, indem sie spezifische Adressaten benennen. Vor allem Sierras Arbeiten tun richtig weh: In New York forderte er Asylbewerber auf, für eine Handvoll Dollar 50 Tage lang jeweils für vier Stunden reglos in Pappkartons zu verharren, anderswo stützten Obdachlose eine nutzlose Museumswand ab, damit sie nicht umkippt. Sierra involviert Niedriglöhner und Arbeitslose in seine (Kunst-)Projekte und kalkuliert damit, dass sich das Kunst-Publikum empören wird. Wird ihm Zynismus vorgeworfen, antwortet er sinngemäß: „Warum regt ihr euch auf?“ Der Glitzerkapitalismus funktioniere nur, weil er andere ausbeute – er lebe von sinnloser Arbeit und auch der Kunstbetrieb sei Teil dieser kapitalistischen Gesamtveranstaltung. Tenor: „Protestiert nicht gegen mein Werk, protestiert gegen die Welt, die darin vorkommt.“ Im Grunde sagt er: „Der Skandal, das seid ihr.“ Das Foto, das wir zeigen, ist im Rahmen seiner Ausstellung in der Lisson Gallery London 2002 entstanden: Sieben Teilnehmer wurden über eine christliche Organisation rekrutiert. Sie sollten über drei Wochen lang täglich eine Stunde lang bewegungslos mit dem Gesicht zur Wand in den Galerieräumen ausharren.
KB: Maja Bajević beobachtet – und das ist auch biografisch bedingt, sie stammt aus Sarajevo – einen zunehmenden konkreten Machtmissbrauch der Religionen durch Politik. In ihrem Film Double-Bubble geht sie diesem nach und fokussiert dabei Widersprüche innerhalb einer demonstrativ zur Schau gestellten Frömmigkeit – wenn es etwa heißt: „Ich befreie Menschen von ihren Sünden. Sie geben mir Geld.“ Oder: „Ich gehe in die Kirche. Ich vergewaltige Frauen.“ Maja Bajević verbindet – da steht sie der Arbeit von Hahnenkamp nahe – gezielt einen gewissen Pathos des zu untersuchenden Gegenstands oder bestimmter Aussagen mit nüchterner Analyse.
JR: Was Maja Bajević meines Erachtens zusätzlich als Frage stellt, ist: Was lösen religiöse Energien aus und wie sind sie formulierbar? Sie fixiert damit ihre Betrachterinnen und Betrachter, tritt diesen an unterschiedlichen, verschatteten Orten entgegen und zählt nicht ihre Liebestaten, sondern ihre Sünden auf. Aber nicht bekennend oder zermürbt, änderungswillig oder reuevoll, sondern mit einer Selbstsicherheit, dass es einem kalt über den Rücken läuft. Gleichzeitig wiederholen Echoblasen ihre Sätze, sodass sie sich mitunter überschneiden: Die Sätze selbst scheinen aber Männersätze zu sein: „I have my wife buried, then I went to see prostitutes.“ Vor dem Hintergrund eines wachsenden Zusammenspiels von Religion und Politik seit den 2000er-Jahren und dem Missbrauch religiöser Bekenntnishaftigkeit, vor dem Hintergrund der Kriegserfahrung in ihrer Heimatstadt Sarajevo spricht Maja Bajević als weibliche Performerin in ihrem Video in sich widersprüchliche Sätze aus: „I have shot 55 people during prayer in the Name of God“. Double-Bubble wird zum Spiegelbild des Missbrauchs von Macht und Religion.
Auch Luc Tuymans’ scheinbar stille Bilder sind voller Anspielungen auf dieses Verhältnis von Macht und Religion – aber ebenso zurückgenommen, wie es nur ein äußerst gebildeter Künstler in Kenntnis der Tradition malerischer Symbolik fortschreiben kann. In Antwerpen lebend, ist Tuymans einem Land mit einem historisch starken Katholizismus entwachsen. Immer wieder kommt deshalb auch das historische Erbe – vor allem jenes der Jesuiten – in seine Bildwelt und wird auf verschiedenen Ebenen thematisiert. Die religiösen Energien der Gegenwart sieht Tuymans mit großer Sorge, denn sie bergen auch Fanatismus in sich. „Es wäre besser gewesen, Theologie als Kunstgeschichte studiert zu haben, um zu verstehen, was sich derzeit in der Welt abspielt“,[31]sagt Luc Tuymans. Im Grazer Mausoleum hat er in der Grabkammer Ferdinands II. und dessen Mutter Maria Anna von Bayern ein Wandbild gemalt. Das Aussehen seiner Blume erscheint genmanipuliert. Welche Gene – wie jene vom Kampf um die „rechte Religion“ oder der „Türkenabwehr“ – wirken im historischen Gedächtnis fort? Mit dem Bau des Mausoleums setzte ab 1614 nicht nur der Barock in Graz ein, das Gebäude ist auch das gebaute Dokument der konfliktreichen Gegenreformation in Graz. Als es 80 Jahre nach seinem Baubeginn fertiggestellt wurde, wurde an der Decke des Hauptschiffs der glorreiche Sieg der christlichen Heere über die Osmanen dargestellt. Die „Gene“ von Religion und Gewalt sind auch in unserem historischen Gedächtnis eingeschrieben.
KB: In der Tat überraschend ist das fragile, kleine Pflänzchen, das Tuymans abseits, in dieser kleinen Kammer gemalt hat, eigentlich viel zu groß für die Verhältnisse des kleinen Raumes vor der Grabkammer. Tuymans hat es dort auch als Seitenhieb und Kommentar auf den Prunk und das Streben nach einer egozentrischen Unsterblichkeit gesetzt. Ein Hadern mit der Vergänglichkeit ist das Secco allemal, bei dem im Unterschied zum Fresko auf den trockenen Putz gemalt wird.
JR: Im Kunsthaus zeigt Tuymans mit The Worshipper (ein Bild aus dem Musée du Masque aus Binche) die Figur eines Geistlichen, der gerade gesegnet zu haben scheint. Aber er erscheint wie ein Geist, versteinert im eigenen Körper. „For me“, sagt Luc Tuymans, „the Worhipper is a rather disturbing painting, almost functioning as an image of a fanatic.“[32]Das 2017 entstandene Bild Candle zeigt auf den ersten Blick das Licht einer Kerze. Doch auch hier sind Zweifel angebracht: Handelt es sich nicht doch eher um einen apokalyptischen Feuerball?
BS: Luc Tuymans zieht die Frage nach der Schuld gleichsam in den Bereich der Malerei selbst. Woran ist sie beteiligt? Er thematisiert die Glaubwürdigkeit von Bildern und Bildmedien im Hinblick auf unser historisches Gedächtnis. Der konkreten Ansprache von Missständen bei Bajević und Sierra und den Schuldgefühlen bei Hahnenkamp steht die Arbeit von Monica Bonvicini gegenüber. Die logoartig anmutende Buchstabenfolge GUILT wird zur Behauptung, Mahnung und Anprangerung ohne spezifische Adressaten, ist aber dadurch auf jeden anwendbar. Ich sehe auch eine Verbindung zu Muntean/Rosenblum, insofern, als sich im Laufe der Jahrzehnte der Schuldbegriff aus dem kirchlich-theologischen Kontext gelöst und in Richtung Populärkultur und Psycho-Coaching verschoben hat. „Guilt“ ist der Titel mehrerer Filme und Musikalben und einer US-Fernsehserie. Das heißt, Schuldbekenntnis, Reue, Vergebung werden zunehmend in Talkshows und Social Media ausgelagert und kommerzielle Anbieter offerieren Dienstleistungen, die von Schuldgefühlen befreien sollen. An der Verbindung von Schuldkultur und Macht – die Erzeugung von übermäßigem Schuldbewusstsein verleiht Macht über Menschen und ihr Verhalten – setzt Bonvicinis grundsätzliches Interesse an: In ihren medienübergreifenden Arbeiten befasst sich die Künstlerin wiederholt mit Machtstrukturen und untersucht die komplexen Beziehungen zwischen physischem und sozialem Raum sowie historische, politische und ökonomische Prägungen, die sich in diese Räume eingeschrieben haben.
JR: In Maria Hahnenkamps Video mit wunderschönen Messkleidern in Nahaufnahmen und aus vollem Pathos gesungenen Kirchenliedern sind Kommentare von Psychoanalytikern eingestreut, die menschliche Befindlichkeiten von Schuld und Abgrund, wie sie in den Liedern manifest werden, erörtern. Jedenfalls wird hier die andere Seite des „Mysterium tremendum liturgicum“ nachfühlbar, an der sich eine Generation an Künstlerinnen und Künstlern abarbeitet, die Gottesdienst nicht nur als sinnliche Überwältigung, sondern auch als Zwang, geistlichen Missbrauch und permanente Schuldgefühle erlebt hat. Heute wissen viele nichts mehr vom kirchlichen Kontext von Opfer und Schuld.
In diesem Kapitel unserer Ausstellung fasziniert mich das geradezu hingeworfen wirkende Lamm von Guillaume Bruère. Bei meiner ersten Führung über „Reizworte aus der Religionsgeschichte“ hat sich eine Dame ob der „Hässlichkeit“ dieses Lammes echauffiert. Ja, natürlich gibt es das von Francisco de Zurbaràn gemalte Lamm: schön, demütig, mit edlem Fell. Dieses hier sieht aus, als wäre es nach der zweiten Lektion in einem Pappmachè-Kurs gemacht worden. Aber so kann man vielleicht viel eher die Provokation ermessen, die bei jeder katholischen Messe kurz vor der Kommunion wiederholt wird: „Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.“ Ich brauche dazu gar keine mittelalterliche Opfer-Theologie kennen. Aber am Karfreitag wird dennoch jährlich konsequent vorgelesen, wie das Lamm zur Schlachtbank geführt wird: „Und es tat seinen Mund nicht auf“ (Jes 53,7).
BS: Bruères Lamm Gottes wirkt – wenn ich nichts vom kirchlichen Kontext weiß – ziemlich surreal. Die gelbe, teilweise lasierend aufgetragene Farbe hat Signalcharakter: „Seht her!“ Durch die Lage des Lammkörpers und seine grob anmutende skulpturale Formung verstärkt sich der Eindruck, es wäre niedergedrückt oder hingeworfen, vielleicht sogar geopfert worden. Doch wirkt es ziemlich lebendig – als ob es das Kreuz wieder zum Leben erweckt hätte. Du hattest bereits darauf hingewiesen, dass Bruère ohne christliche Prägung aufwuchs und erst im Zuge eines Nachbuchstabierens christlicher Bildsprache zur Faszination für den christlichen Glauben fand. Es ist doch erstaunlich, wie sehr er in seiner Darstellung das „Lamm Gottes“ auf den Punkt bringt.
JR: Was mich bei ihm als Kurator mehrfach tief berührt hat, ist seinBetroffensein angesichts von Bildern, die förmlich mit ihm zu sprechen scheinen. Als er 2016 in Graz war, um Flüchtlinge zu porträtieren, hatte er in einem Kloster aus dem 19. Jahrhundert übernachtet. Dort sah er eine Madonna. Auch sie schien mit ihm zu „sprechen“: Zurück in Berlin malte er in unglaublicher „Erinnerung“ an diesen Aufenthalt eine „Immaculata“, wie sie sicher noch nie gemalt worden ist.„Vorbild“ war eine der Darstellungen der Jungfrau Maria, wie sie seit dem 19. Jahrhundert als Fatima- oder Lourdes-Madonnen weltweit bekannt sind. Eine Nonne gab ihm auch eine dieser „wundertätigen Medaillen“, die viele gläubige Menschen an ihrem Körper tragen: Bruères Bild ist nur auf den ersten Blick „kindlich-krakelig“. Er fragt sich: Wie kann ein millionenfach gemalter „Unschuldskörper“ noch einmal jene Unschuld ausstrahlen, für die er eigentlich steht? Verletzlich, auch im bildlichen Sinne „nackt“: Und auf französisch in den roten Bildhintergrund eingeritzt steht: „O Maria, ohne Erbsünde empfangen, bitte für uns arme Sünder ...“
-
[29]Vgl. Werner Hofmann, „Die Geburt der Moderne aus dem Geist der Religion“, in: ders. (Hg.), Luther und die Folgen für die Kunst, Ausst.-Kat. Kunsthalle Hamburg, 11.11.1983–8.1.1984, München 1983, S. 23–71.
-
[30]Vgl. Priesch, Chapel of Pain, Weitra 2018.
-
[31]Vgl. Luc Tuymans, Wenn der Frühling kommt, mit Texten von Stephanie Rosenthal und Luc Tuymans, Ausst.-Kat. Haus der Kunst, München, 2.3.–12.5.2008, München 2008, S. 80.
-
[32]„When Spring Comes. A Guided Tour with Luc Tuymans“, in: ebda., S. 9–13, 13.
