DIE MASCHINE TRIFFT DAS HEILIGE - Flavius Josephus‘ Antikriegsbericht "De Bello Judaico"
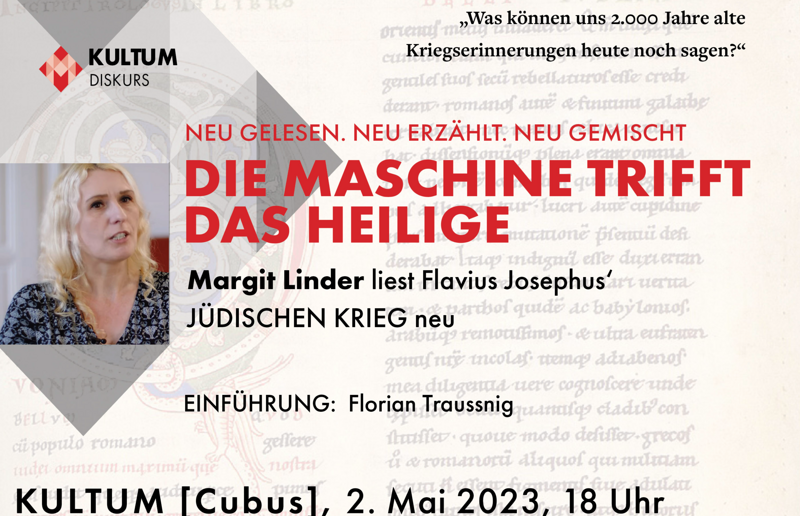
Mit den eben zitierten Worten einer im ostukrainischen Tschernihiw lebenden Studentin führte Diskurskurator Florian Traussnig in die Neu-Lesung eines aufrüttelnden historischen Berichts über den Jüdischen Krieg (66 – 70/73 n. Chr.) ein. Der im März 2022 erfolgte russische „Streubombenangriff“ auf Tschernihiw mag in seiner Unmittelbarkeit und in der Wucht des Jetzt, also des heutigen Ukrainekriegs nahezu apokalyptisch, ja fast singulär wirken. Und doch – schon seit tausenden von Jahren sind Menschen, gerade Zivilistinnen oder am Kriegstreiben Unbeteiligte, immer wieder mit der geballten Zerstörungskraft der Militärmaschinerie und technisch ausgeklügelten „Monstren“ (so der Althistoriker Yann Le Bohec) konfrontiert. Und seit tausenden von Jahren schreiben sie diese Erfahrungen auf, arbeiten sich an ihnen ab und versuchen so ihre erschütterte Welt geistig wenigstens ein bisschen zu sortieren. Im Rahmen der solche Krisen-, Kriegs- und Katastrophentexte aufgreifenden Diskursreihe NEU GELESEN. NEU ERZÄHLT. NEU GEMISCHT. blickte die Althistorikerin und Klassische Archäologin Margit Linder in den geistesgeschichtlichen Rückspiegel und beleuchtet den Jüdischen Krieg aus der Sicht des jüdisch-römischen Geschichtsschreibers Flavius Josephus (37 bis ca. 100 n. Chr.), der als Chronist einer dramatischen Zeit die religiösen und kriegerischen Erschütterungen einer Epoche erfasst und gedeutet hat. Es war die Epoche der römischen Besatzung Judäas, des Auftretens einer Figur namens Jesus von Nazareth, der Niederwerfung des jüdischen Aufstands und der Zerstörung Jerusalems. Wie hallt dieser Text ins Heute nach, was davon ist archaisch, was zeitlos?
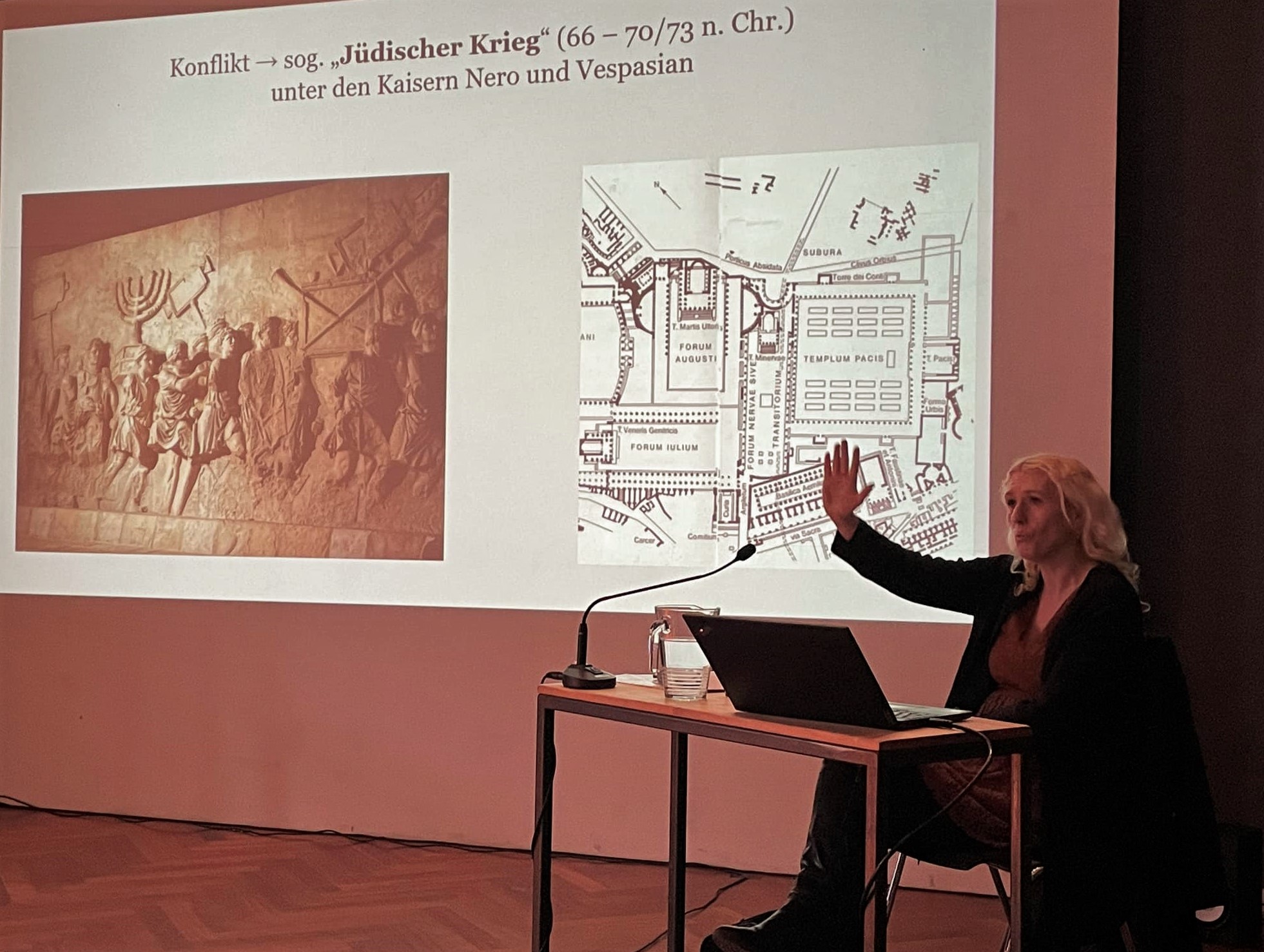
Wendehals oder Stimme der Vernunft?
Im Jahre 66 n. Chr. kam es in der für das Imperium Romanum strategisch bedeutenden Region Judäa und Galiläa „zur Revolte der Juden gegen die Oberherrschaft der Römer – eine Auseinandersetzung“, so Linder, „die von den Römern mit absoluter Härte niedergeschlagen wurde. Dieser Krieg, der im Jahre 73 n. Chr. endete, ist uns durch die Überlieferung des Flavius Josephus, der selbst als Feldherr tätig war und das Ende dieses Konfliktes auf römischer Seite stehend miterlebte, überliefert.“ In seiner Einführung bezeichnete Traussnig Flavius Josephus, der sich ursprünglich Joseph ben Mattitiahu ha-Kohen nannte und sich entgegen der Abmachung mit seinen fanatischen Mitstreitern dem Freitod entzog, indem er zu den Römern überlief, als ambivalente Figur. War er laut der Historikerin Mary Beard entweder ein „traitor, asylum-seeker or far sighted politician“ – vielleicht auch alles zusammen –, so arbeitete Linder in ihrem Vortrag die pazifistische, empathische und rationale Seite des Flavius Josephus heraus. Der laut Linder auch aufgrund zahlreicher Provokationen römischer Soldaten gegenüber den jüdischen Gläubigen letztlich wohl unvermeidbare Konflikt zwischen den Juden und der „Mutter der neuzeitlichen Armeen“ (John Keegan), sei nicht nur durch römische Respektlosigkeiten, sondern durch besonders heißköpfige jüdische Gruppen wie die „tyrannischen“ Zeloten und Sikarier befeuert worden. Die nicht zuletzt im Neuen Testament oft als repressiv und verschlagen dargestellten Pharisäer respektive die rationale jüdische Priesterelite, der Josephus nahestand, wären hier durchaus um Mäßigung und Vermeidung von Blutvergießen bemüht gewesen, so Linder. Doch letztendlich kam es zum Krieg und Josephus schrieb mit Inbrunst gegen den Krieg, den er nicht wollte, an.

Personalisierte Leidensgeschichte
„Josephus“, so Linder, der vieles, „worüber er schreibt, selbst miterlebt hat, schildert […] nicht nur die Abläufe der einzelnen Vorkommnisse präzise, sondern ebenso die Vorgeschichte und vermittelt somit auch die Gründe bzw. Anlässe, die zum Aufstand der Juden und damit schließlich zum Krieg führten." Josephus‘ Text, so die Professorin an der Uni Graz, sei nicht nur eine historische Dokumentation, sondern ein einfühlsamer Ausdruck der jüdischen Leidensgeschichte. Zwischen den Stühlen der Römer und der Juden stehend, habe der zuvor „mäßig erfolgreiche jüdische Feldherr“ einerseits „die schonende Haltung der Römer“ gelobt und die fanatischen Stimmen auf jüdischer Seite kritisiert, andererseits habe er die Brutalitäten der römischen Soldaten und die Verheerungen des Krieges mit Blick auf die Nachwelt geschildert. De Bello Judaico „ist einer der ersten Antikriegsberichte“, so Linder. Josephus war demnach von den Verwerfungen seiner Zeit ebenso „stark erschüttert“ wie die ukrainischen Hauswände (und Menschen) es im Krieg heute sind. In seinem historischen Bericht montierte er sich selbst („Josephus war dort“) als direkter Beobachter und erlebendes Ich an mehreren Stellen in den Text hinein. Mit solchen „Cameo-Auftritten“ habe er es vermocht, so Linder, die apokalyptische Wucht der großen Steinwurfmaschinen in der von den Römern belagerten Bergfestung Jotapata (die er 67 n. Chr. noch als Militärkommandant auf Seiten Galiläas miterlebte) sichtbar zu machen. Die laut Linder bis zu 26 Kilogramm schweren Steine einer römischen Ballista-Wurfmaschine und diverse andere „Monstren“ richteten „in der nächsten Nähe“ ungeheuren Schaden, so der antike Chronist:
„Man kann die Kraft dieser [Kriegs]Maschine aus folgenden Vorfällen jener Nacht [im Zuge von Kampfhandlung innerhalb der Stadt Jotapata] ersehen: Aus der nächsten Umgebung des Josephus wurde einer auf der Mauer von einem Steingeschoss so getroffen, dass sein Haupt abgerissen und die Hirnschale noch drei Stadien weit geschleudert wurde. Eine schwangere Frau, die kurz nach Tagesanbruch gerade aus dem Haus trat, wurde auf den Unterleib getroffen und das Kind aus dem Mutterleib heraus eine halbe Stadie weit fortgerissen – eine solch entsetzliche Wirkung hatte die Steinschleudermaschine. Unaufhörlich erklang der dumpfe Aufschlag der Gefallenen, die von der Mauer herabstürzten, furchtbar war das Geschrei, dass die Frauen in den Häusern anstimmten, es mischte sich mit den Seufzern der Sterbenden draußen. Die ganze Mauer, soweit sie den Kampfplatz begrenzte, troff von Blut und war über die Menge der Leichen ohne Mühe zu ersteigen; die Berge ringsum ließen den Lärm noch schauerlicher widerhallen.“
Haben wir nichts aus der Geschichte gelernt?
Seine grausame Klimax erreicht der Text je näher das Geschehen ans Heilige rückt: den Jerusalemer „Tempelberg“. Dort, so das naturalistische Lamento des zu diesem Zeitpunkt (70 n. Chr.) bereits längst zu den Römern übergelaufenen Historikers, sei „von seinem Fuße ab nur noch eine brodelnde Masse“ gewesen; „[v]or lauter Leichen war nirgends mehr der Erdboden zu sehen“. Wie auch immer man zum rhetorischen Lavieren zwischen römischer und jüdischer Identität und zu den mitunter opportunistisch wirkenden Lebensentscheidungen des Titus Flavius Josephus stehen mag: In seinem Kriegsbericht über „fürchterliche Leidensszenen“ und den Verlust des „Heiligen“ sowie „Mord“ und „Plünderung“ durch römische Soldaten schwingen eindeutig ein pazifistischer Grundton sowie eine individuelle wie universelle Reflexion über den kriegsführenden Menschen mit. Ein Wesen, das wenig aus seiner blutigen Geschichte gelernt hat. Dennoch bleibt nichts anderes, als uns mit solchen in Buchstaben geronnen menschlichen und materiellen Erschütterungen auseinanderzusetzen. Immer wieder und wieder. „Man kann aktuelle Dinge nicht richtig einschätzen, und das, was morgen kommt auch nicht akkurat gestalten, wenn man das, was gewesen ist, nicht richtig versteht“ – sagt Margit Linder in einem Youtube-Kurzvideo der Uni Graz. Solche Texte neu zu lesen, neu zu erzählen, mit der heutigen Realität abzugleichen und gewisse Erkenntnisse daraus in unseren so völlig anderen, aber vielfach dem – überwunden geglaubtem – „Alten“ gleichenden Lebensvollzug hineinzumischen, lohnt sich also weiterhin.
Kann man den Krieg je begreifen? Wann ist Widerstand, wann ist ein Aufstand gerechtfertigt? Wie „übersetzt“ man die leidvollen Erfahrungen vorangegangener Generationen am besten für die Nachgeborenen? Diese Fragen bleiben auch nach den engagierten und unprätentiösen Ausführungen von Margit Linder zu weiten Teilen wohl offen. Fasst man Kriegsberichte nicht nur als historische Artefakte, die es zeitgenössisch und skeptisch zu sezieren gilt, sondern auch als kulturelle Gedächtnisspeicher, als Kunst des Begreifen-Wollens auf, dann ist das Zitat des jungen Schauspielers Felix Kammerer, der die Hauptrolle bei der Neuverfilmung des Antikriegsfilms „Im Westen nichts Neues“ gespielt hat, bedenkenswert. Über die Faszination am Theater bzw. an einer solchen „Übersetzungs“-Kunst generell sagt er: „Es ist das Interesse an der Auseinandersetzung mit Dingen, die wir nicht begreifen können. Wir machen Kunst, weil wir etwas beschreiben wollen, das größer ist als wir das wir nicht benennen können. Wir suchen Übersetzungsmöglichkeiten […].“
Florian Traussnig
Zur kurzen Bildnachlese
