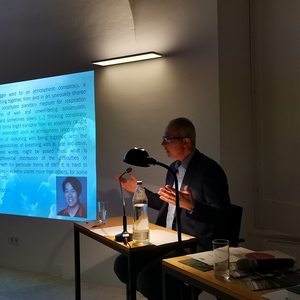RESPIRATORY DEMOCRACY - Bericht über das ATEM-Diskurspanel beim „Minoritenfest“
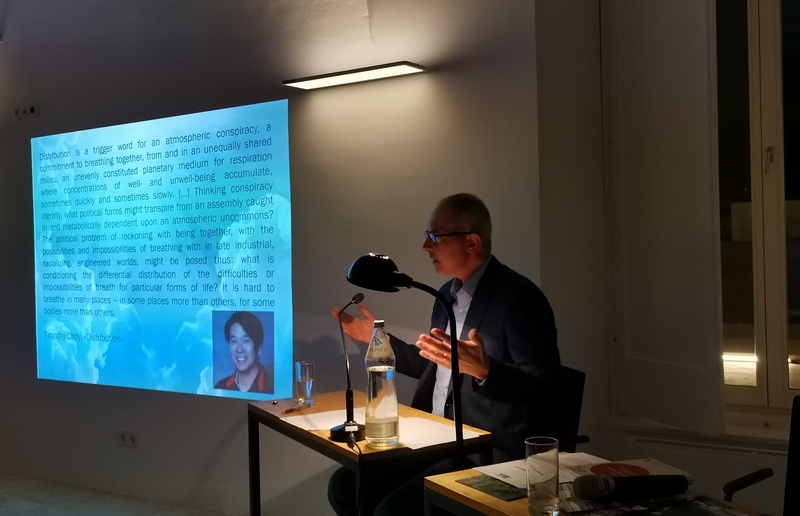
Therapie durch Technologie? Linn Burchert blickt auf die Ambivalenzen des Atems in der Kunst
Wie wird das Konzept der „Inspiration“ in Moderne und Gegenwart künstlerisch interpretiert? Das fragte sich die Berliner Kunsthistorikerin Linn Burchert bei Ihrem Vortrag Atem in der Kunst: Technik zwischen Zwang und Befreiung. Ausgehend vom 2005 in Los Angeles gezeigten interaktiven Werk Exhale der Künstlerin Thecla Schiphorst, bei der die Besucherinnen und Besucher Kleidungsstücke mit eingearbeiteten Ventilatoren und Vibratoren tragen, welche auf den Atemrhythmus reagieren und so zum synchronen Atmen animieren sollen, skizzierte – und problematisierte – Burchert den Atem als Teil künstlerischer Praktiken seit 1900. Dabei zeigte sie auf plastische Weise Ambivalenzen auf, die teils bis heute fortwirken: Atem in der Kunst oszilliere demnach zwischen Befreiungsversprechen und Zwang und er sei gleichzeitig Medium der Produktion wie auch des Wahrnehmens. Während Arthur B. Davies, der die Ansicht vertrat, „dass der idealen Kunst Atem inhärent sei“, versuchte, mit an antike Tempeltänze gemahnenden Bildern psychoästhetisch – und Heilsansprüche weckend – auf den Atem der Rezipierenden einzuwirken, verfolgte Bauhaus-Meister Johannes Itten in der zunehmend abstrakten Moderne den reformpädagogischen Ansatz, durch künstlerisch angeleitete Atemkontrolle Herzschlag und Denken zu beeinflussen, etwa in dem man im Rhythmus des Zeichenprozesses atmet. Burchert skizzierte auch weniger anheimelnde bzw. an Wellness grenzende Ansätze: In Anlehnung an Friedrich Nietzsche („[D]er Rhythmus ist ein Zwang“) agierte der US-Amerikaner Mark Rothko mit seinen – etwa in Luxushotels aufgehängten – Seagram Paintings bewusst „maliziös“. Seine Bilder sollten den Gästen bzw. Betrachter*innen jeglichen Appetit verderben, sie förmlich einengen, zum Leiden bringen und eine ästhetische Atemnot herbeiführen. Einer solchen, letztlich auch therapeutisch-heilsam ausgerichteten Anpassung von Atmung und Puls an das Bild stand die Poesie Gertrude Steins entgegen, die ihre Texte ohne Beistriche verfasste und nicht rhythmisierte. Damit habe sie auch andere politisch-emanzipatorische Konzepte des 20. Jahrhunderts beeinflusst. Die Partizipationskunst seit 1960, so Burchert, umkreise bis heute die Ambivalenz von Zwang und Freiheit: Bei Lygia Clark etwa bedeute Atemkontrolle einerseits Therapie, andererseits stünde sie für biopolitische Machtausübung. Zurückkommend auf die eingangs erwähnte und von ihr pointiert als „Lebensreformbewegung 2.0?“ bezeichnete Arbeit Exhale von Schiphorst, zog Burchert ein nachdenkliches Resümee: Eine solche technologiegestützte Immersion, die die Rezipientinnen und Rezipienten mit dem Kunstwerk unmittelbar verbindet und eigentlich durchaus partizipativ-demokratisierende Züge aufweist, lasse laut Burchert oft eine kritische Distanz zum körperlichen (und manipulierbaren) Erleben dieser bio-technologischen Atemsteuerung vermissen. Die „unheimliche“ Technik des Biofeedback werde bei solchen Werken im Sinne einer Techno-Utopie affirmativ angewandt und nicht allzu kritisch hinterfragt.
Lesen Sie hier Linn Burcherts Essay zum Thema
„Lieber mal den Atem anhalten“ ist keine Option: Nikola Roßbach über Cancel Culture
An die in der Ausstellung EINATMEN – AUSATMEN im KULTUM gezeigte Arbeit des Künstlers Michael Endlicher „Ich möchte folgendes klarstellen“ knüpfte der sprach- und gesellschaftspolitisch engagierte Vortrag Atemnot - zu alten und neuen Unfreiheiten der Rede der Kasseler Germanistin Nikola Roßbach an: Die in Endlichers Video artikulierten, schier endlos wirkenden Entschuldigungs- und Distanzierungsfloskeln in Richtung aller möglichen gesellschaftlichen und weltanschaulichen Gruppen weisen frappierende Parallelen mit jenen sprachlichen (Selbst-)Zensurbestrebungen auf, die heute durch Identitätspolitik sowie durch Political Correctness und Cancel Culture befeuert werden. „Zensur“, so die Literaturwissenschaftlerin, „bedeutet immer Gewalt“ und „versehrt Texte, verändert oder vernichtet sie“. Man dürfe jedoch, so Roßbach, heutige sprachliche Beschränkungsformen und die „Sehnsucht nach Grenzen“ nicht mit der klassischen – also staatlich oder institutionell verankerten und in der Regel nur in Diktaturen auftretenden – Vorzensur gleichsetzen. Die Literaturwissenschaftlerin arbeitete in Folge heraus, dass es dennoch einen neuen, ja teils regelrecht atemraubenden Zwang des „Don’t say that!“ gebe, der sich jedoch nicht (mehr) aus einer konservativen, sondern eher von einer linksemanzipatorischen, identitätspolitischen und minderheitenorientieren Moral speise. Auch wenn sie mit ihrem „entschieden unentschiedenen“ Standpunkt die hehren Absichten hinter den daraus resultierenden Sprachpolitiken nachvollziehen kann, übte Roßbach – wie später auch Teile des Publikums – doch sichtlich Kritik an den dogmatischen Auswüchsen und „cancelnden Strukturen“, die mitunter regelrecht zu einer diskursiven Atemnot durch (Selbst-)Zensur führen würden. Als Beispiel nannte sie u.a. die Ausladung eines Kolonialismusforschers, der aktiv und kritisch an der Aufklärung von Kolonialverbrechen mitwirkte, von einer einschlägigen wissenschaftlichen Veranstaltung – weil er eben nicht schwarz ist. Die Welt oder die Universität, so die Germanistin, wären jedoch kein „safe space“ für alle individuellen Befindlichkeiten und wenn Unzumutbares geäußert wird, müsse „man eben streiten“ und das „robuste Gespräch“ aufrechterhalten. Aus lauter Angst, ein falsches „Triggerwort“ zu verwenden und damit Menschen möglicherweise zu verletzen, „lieber mal den Atem anzuhalten“, sei definitiv keine Option, so Roßbach. Gleichwohl sollten alle jene, die einen „Vorsprung“ haben (Weiße, Männer, Heterosexuelle, Nicht-Behinderte usw.) stets reflektieren, von welcher – privilegierten – Position aus sie sprechen. Da Wandel, auch sprachlicher Wandel, nicht dogmatisch erzwungen werden könne, müsse man einer sprachpolitischen Vorsichtskultur letztlich eine klare Absage erteilen.
Lesen Sie hier Nikola Roßbachs Essay zum Thema
Wir, die „Community of Breathers“: Lenart Škofs Vision einer atmenden Demokratie
„If we protect and nurture our breath, but also the breaths of others, including those of nonhuman beings, in short the atmosphere, we defend the very materiality of life – i.e. life at its ontological core“ – wie dieser Auszug aus dem Impuls von Lenart Škof zu Beginn des ATEM-Diskurspanels zeigt, war der englischsprachige Beitrag Respiratory Democracy / Atmende Demokratie des slowenischen Philosophen Lenart Škof mehr eine intensive Meditation über eine neue politische Ethik als ein klassischer Wissenschaftsvortrag: Unserer politisch respektive ökologisch von „flames of violence and bad air“ gekennzeichneten Gegenwart hält er einen Ansatz entgegen, der ausgehend vom Grundsatz „Democracy Begins Between Two“ (Luce Irigaray) eine „radikale Neugestaltung und Erweckung“ zum Ziel hat. Dazu brauche es eine „respiratory alliance“ und einen Fokus auf „relational belonging, ethical affectivity, our belonging to nature, and life“, der nur über eine Wiederentdeckung des von der westlichen Philosophie laut Škof weitgehend vergessenen – und nun von Stimmen wie Luce Irigaray und Bruno Latour quasi wiederentdeckten – Atems möglich sei. Wir alle seien Teil von atmosphärischen Beziehungen, Teil eines atmenden Netzes, so der Philosoph. Dem „ungleich verteilten planetarischen Medium für den Atem“ (Timothy Choy) müsse mit respiratory solidarity begegnet werden. Eine Solidarität, die sich natürlich auch politisch manifestiert, wie man bei den Protesten zum atempolitisch schreiend ungerechten Erstickungstod des Afroamerikaners George Floyd („I can’t breathe“) oder im afrikanischen Liberia sieht, wo es vor allem Frauen waren, die mit „breath, prayer, care for life, and silence“ auf sanfte, aber radikale Weise den Friedens- und Versöhnungsprozesse beinflussten. Zum Atem gesellt sich das Feuer, das seit der industriellen Revolution seiner mythologisch-nährenden Kraft beraubt und im vergangenen „century of violence“ unheilvoll militarisiert worden sei, so Škof. Dennoch, so der Leiter des Instituts für Philosophische Studien am Wissenschaftlichen Forschungszentrum Koper, brauche es neben einer neuen Ethik des Atems auch das Feuer, um die Menschheit im positiven Sinne anzuheizen, sich auf eine neue „Konspiration“ der Kreativität und Zugehörigkeit zuzubewegen. Letztlich gebe es in allen Mythologien und Religionen eine spirituelle Anleitung, seinen Atem im Sinne einer nicht egoistischen self-affection zu entdecken und intensiv wahrzunehmen und dadurch einen ebenso produktiven wie empathischen Link zwischen dem eigenen Mikrokosmos und dem Makrokosmos der restlichen Welt, also auch den mitatmenden Geschöpfen, zu schaffen. Eine atmende Demokratie, so der das Publikum in seinen Bann ziehende Škof in Anlehnung an Peter Sloterdijk, ist kommunitär ausgerichtet, leise, aber gleichzeitig stark, spricht „resolut für die Unterdrückten“: „[O]ur quiet democracy nourishes what Sloterdijk would call the breathed commune. Respiratory democracy is the community of breathers.“
Lesen Sie hier Lenart Škofs Essay zum Thema (English Version)
Zusammengefasst von Florian Traussnig